© 2016 Getty Images
Ein 0:5-Rückstand, der Gegner am Drücker, das Publikum schreibt das Match schon ab – und trotzdem kann im Tennis alles kippen. Die größten Spiele entscheiden sich nicht mit der Rückhand, sondern im Kopf. Wie Spieler in Drucksituationen ihr bestes Tennis abrufen, erklärt Mentalcoach Wolfgang Seidl.
© pixabay
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenTennis gilt nicht nur als physisch anspruchsvoller Sport, sondern vor allem auch als ein Spiel der mentalen Stärke. Im Gegensatz zu vielen Mannschaftssportarten steht die Spielerin oder der Spieler allein auf dem Platz. Tennis ist ein Einzelsport mit oft langen und unvorhersehbaren Spielzeiten. Ein Beispiel dafür sind die aktuell zwei besten Tennisspieler der Welt: Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.
Beide sind bereits mehrere Male auf der ATP-Tour gegeneinander angetreten. Zuletzt bei den Cincinnati Masters war aufgrund der Aufgabe von Sinner bereits nach 23 Minuten Schluss. Gleichzeitig lieferten sie ein paar Monate zuvor das längste Finale der French Open aller Zeiten – mit fünf Stunden und 29 Minuten!
In diesem Zeitraum sind die Protagonisten auf sich allein gestellt. Da externes Coaching kaum erlaubt ist, müssen die Profis selbst mit dem Spielverlauf umgehen und ihre Emotionen kontrollieren. »Gerade weil es im Tennis viele Fehler und Rückschläge gibt, ist der Umgang damit entscheidend«, erklärt Mentalcoach Wolfgang Seidl im Gespräch mit dem Sport Business Magazin. Für ihn ist klar: Mentale Stärke ist im Tennis kein Bonus, sie ist Grundvoraussetzung für Erfolg und das Resultat harter Arbeit.
© AELTC / Florian Eisele
Druck abseits des Platzes: Reisen, Jetlag, Heimweh
Nicht nur auf dem Center-Court lauern Herausforderungen: Reisen um die halbe Welt, der Kampf gegen den Jetlag, ungewohnte kulturelle Neuländer, Ernährungsprobleme in unbekannten Turnierländern, Heimweh – das kostet Energie. »Besonders für junge Spieler ist es belastend, wenn die vertraute Umgebung fehlt«, erklärt Seidl. Um sich schneller einzuleben, empfiehlt er, gezielt das Positive zu suchen – sei es durch Vorfreude auf landestypisches Essen oder eine klare Tagesstruktur. Ein Dauerbrenner ist die öffentliche Wahrnehmung. »Medien zeichnen oft ein verzerrtes Bild. Deshalb ist es wichtig, Distanz in Form eines inneren Schutzschilds aufzubauen und das Selbstwertgefühl zu stärken«, betont der Mentalcoach.
Hinzu kommen Verletzungen. Ein verletztes Handgelenk wie bei Dominic Thiem, das 280 Tage Verletzungspause für ihn bedeutete – für Profis, deren Existenz und Karriere von Erfolgen und Sponsoren abhängt, ein Albtraum. »Da geht es nicht nur um Heilung, sondern auch um Vertrauen in den eigenen Körper«, erläutert der Experte für mentale Stärke. Seidl arbeitet in solchen Situationen in ärztlicher Absprache mit klaren Zwischenzielen und mentalen Übungen, um Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen. Auch Niederlagen in wichtigen Spielen erfordern einen Perspektivwechsel: Statt sich auf das Ergebnis zu fixieren, solle der Fokus stärker auf den Prozess gelegt werden.
© Mirja Geh / Red Bull Content Pool
Der innere Kritiker: Good Guy vs. Bad Guy
Das innere Ringen mit sich selbst und den vorhandenen Zweifeln gehören zum Alltag eines Tennisprofis dazu. Seidl beschreibt die inneren Stimmen, die im Kopf jedes Tennisspielers kämpfen: den »Good Guy«, der motiviert und das Selbstvertrauen stärkt, gegen den »Bad Guy«, der Zweifel streut und auf mögliche Niederlagen oder vermeintliche Schwächen hinweist. Wer lernt, stärker auf den »Good Guy« zu hören, kann besser mit Druck und Nervosität umgehen. Es ist hilfreich, Spielern bewusst zu machen, dass beide Stimmen existieren, denn am Ende des Spiels sind die Profis auch nur Menschen mit positiven und negativen Gefühlen.
Jeder Teil hat seine Daseinsberechtigung, aber keiner sollte die Kontrolle zu stark übernehmen, im Idealfall herrscht ein Gleichgewicht. Den »Bad Guy« bezeichnet der Mentalcoach als »inneren Kritiker«, der durchaus wichtig ist, denn ohne ihn gäbe es keine Weiterentwicklung und erstrebenswerten Ziele. Gerät das Gleichgewicht ins Wanken oder ist die Nervosität zu groß, gilt es mental dagegen zu steuern. Seidl arbeitet dabei mit festen Routinen wie Atemtechniken, Achtsamkeitsübungen oder Meditation. Wer es schafft, den Kritiker in Schach zu halten und der positiven Stimme mehr Raum zu geben, kann auch in scheinbar aussichtslosen Situationen bestehen.
© 2016 USTA
90 Sekunden, die über Sieg und Niederlage entscheiden
Während eines Matches bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Und doch liegen in genau diesen kurzen Pausen oft der Schlüssel zum Sieg. »Die Spieler haben für den Seitenwechsel 90 Sekunden – die müssen sie so effizient wie möglich nutzen«, erklärt Seidl. Solche Routinen wirken simpel – doch sie entscheiden, ob ein Spieler im fünften Satz im Tiebreak noch die Nerven behält. Diese Pause lässt sich in vier Phasen unterteilen:
- Vom Platz auf die Bank – Analyse des letztgespielten Punkts
- Entspannungsphase – mit bewusster Atmung versuchen, runterzukommen, kurz Nahrung aufnehmen und sich zur Erholung von der Konzentration lösen.
- Vorbereitungsphase – Analyse des vergangenen Games und genaue Anweisungen zur Verbesserung des eigenen Spiels
- Aktivierungsphase – Fokussierung durch Aktivierungsübungen wie Sprünge oder Brustklopfen auf dem Weg zurück zum Platz
© Upper Austria Ladies Linz
Auch Weltstars kämpfen mit Mentalproblemen
Das Tennis lebt wie jeder andere Sport von Emotionen. Sie gehören dazu, aber nicht jeder versteht sie. Manchmal werden sie auch von einigen Experten als Schwäche gesehen, wenn Spieler sich ins eigene mentale Konstrukt schauen lassen. Dabei braucht es eine gehörige Portion Mut, mentale Probleme zuzugeben.
In der Tennisweltspitze ist jetzt Alexander Zverev betroffen. Der Olympiasieger konnte bisher keinen Grand-Slam-Titel holen, schaffte es aber bereits mehrmals ins Finale. Nach der Erstrundenniederlage in Wimbledon gab er seine mentalen Probleme in der Öffentlichkeit preis. Er machte bewusst eine Pause und holte sich zum ersten Mal professionelle Hilfe. Diese Hilfe ließ ihn wieder gestärkt und erholt auf die ATP-Tour zurückkehren. Er betonte aber auch, dass dies ein »Schritt in die richtige Richtung, aber ein Prozess über möglicherweise mehrere Jahre« sei.
Zverevs Geständnis rüttelte nicht nur den Tennissport wach, er löste damit eine wichtige Debatte über die psychische Gesundheit im Spitzensport aus und machte klar, wie wichtig Offenheit und therapeutische Unterstützung bei Weltklasseathleten sind.
© pixabay
Djokovic und die Kraft der Emotionen
Ein weiterer Tennisstar, der sich über das Thema Emotionen äußerte, hält den Rekord für die meisten Grand-Slam-Titel: Novak Djokovic. Der Serbe gab in Interviews an, in »jedem Match« Zweifel und emotionale Aussetzer zu haben. Schläger zertrümmern, schreien, die Hände zum Himmel recken – Bilder, die Tennisfans weltweit kennen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der absoluten Weltklasse und dem Rest der Welt – nicht zu lange im emotionalen Ausbruch zu bleiben. »Bewusst durch Atmung sich selbst herunterregulieren«, verrät der »Djoker« sein Geheimnis.
Für Seidl ist das Zeigen eigener Emotionen kein Zeichen von Schwäche: »Es ist wie ein Kochtopf – wenn der Druck nicht abgelassen wird, explodiert er.« Wichtig sei jedoch, den Ausbruch zu kontrollieren und den Fokus wieder neu auszulegen. Der beste Weg dafür ist die sogenannte »Dreier-Technik«: Zuerst dürfen die Emotionen raus, dann führt bewusstes Durchschnaufen zurück zur inneren Mitte, bevor der Fokus wieder klar auf das Match gerichtet wird.
© Markus Gilliar / Daimler AG
Federer als Vorbild: Mentale Stärke ist lernbar
Wenn Seidl von mentaler Stärke spricht, fallen die Namen Djokovic, Nadal und Federer. Djokovic beeindruckt ihn mit seiner Resilienz, Nadal mit unbändigem Kampfgeist, Federer mit seiner Entwicklung bereits in jungen Jahren vom emotionalen Hitzkopf zum Inbegriff von Coolness. »Mentale Stärke ist formbar. Man kann sie lernen – wenn man bereit ist, daran zu arbeiten.«
Ob Grand-Slam-Finale oder Nachwuchsturnier, für den Mentalcoach gilt eine universelle Wahrheit: »Je früher man beginnt, mentale Routinen aufzubauen, desto leichter ruft man in Druckmomenten sein bestes Tennis ab.« Denn am Ende, so Seidl, ist der Schläger nur Werkzeug. Der entscheidende Schlag fällt im Kopf über Spiel, Satz und Sieg. 


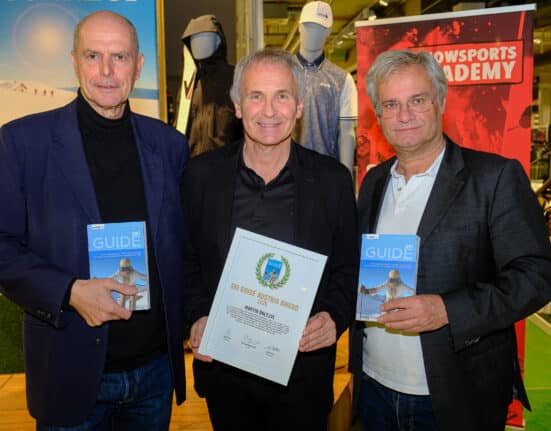

![#VICTOR2025: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober ist Sport-Managerin des Jahres [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/11/oesv_portr2024_109-551x431.jpg)


![Die 35 besten Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen des Sportjahres 2025 [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/VICTOR-2025-Sport-Business-Magazin-551x431.jpg)
![Die Tabelle lügt immer: Über die Macht des Zufalls im Fußball [Empfehlung]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/event9202-551x431.jpg)


![Die 35 besten Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen des Sportjahres 2025 [Exklusiv]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/VICTOR-2025-Sport-Business-Magazin-450x595.jpg)
![Die Tabelle lügt immer: Über die Macht des Zufalls im Fußball [Empfehlung]](https://sportbusinessmagazin.com/wp-content/uploads/2025/10/event9202-450x595.jpg)
